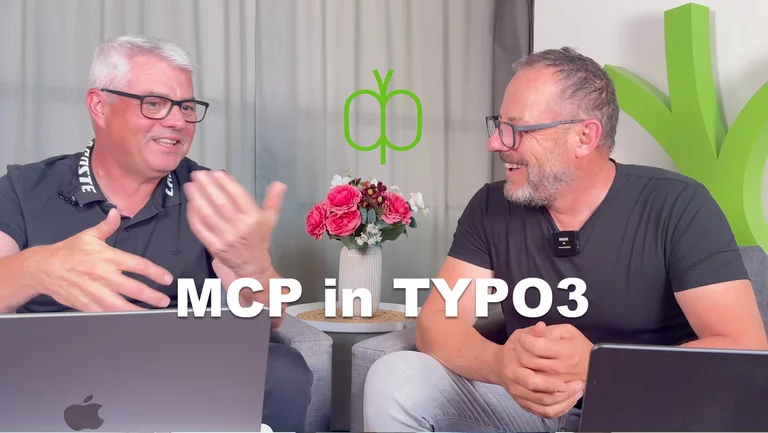Erich: Eine Hybridversion. Das Beste kann man sagen aus beiden Welten, aus der Headless- und aus der klassischen CMS-Welt. Was heisst der CMS-Ansatz für die tägliche Arbeit des Content-Redakteurs?
Dani: Die Content-Erstellung wird strukturierter. Statt in Seitenlayouts - wie wir es kennen - zu denken, schafft dann eigentlich der Redakteur mit wiederverwendbaren Inhaltsbaustein. Und diese wiederverwendbaren Inhaltsbausteine können dann wieder zu Seiten erbaut werden anhand dieser Bausteine. Nur musst du dann wieder die Relationen dieser Bausteine haben, damit sie nachher auf der Seite wieder richtig ausgegeben werden. Wie ruft man dann diese Bausteine ab? Wo liegen diese Bausteine? Wie kann ich mit diesen umgehen. Aber ich meine, du warst ja schon genügend lange unterwegs in der Industrie. Was waren deine Erfahrungen in diesem Bereich?
Erich: Ich habe es vorher schon mal angekündigt, vielmals scheitert es am technischen Verständnis der Leute und dem Verständnis, wie man Daten strukturiert und Daten aufbaut. Und das führt dann dazu, weil der Headless-Ansatz ja auch von der Content-Aufbereitung anders ist, dass man immer mehr wieder in Richtung des alten Ansatzes geht. Das Headless-System vergewaltigt in diese Richtung hinein, wie der klassische Ansatz war. Dann verliere ich den ganzen Vorteil des Headless-Systems, den ich hatte. Dann habe ich einfach ein Headless-CMS, das umgebaut wurde als ein klassisches CMS. Und das wird dann einfach brutal teuer und kostet wirklich einfach denjenigen, der das macht und verliert alle die Vorteile.
Dani: Aber war trendy. Er hat das Headless-CM eingeführt.
Das ist der Vorteil. Zusammenarbeiten bei Headless ist wirklich wichtig und auch Marketing und Technik müssen intensiver zusammenarbeiten.
Wenn ich dann keine Technik-Know-how habe, wird es noch schwieriger und eben die Agenturen reiben sich die Hände, weil sie Arbeit haben euch zu unterstützen und zu helfen. Wir haben abschliessend als Zusammenfassung zu sagen, dass es ein Ansatz für Grossunternehmer ist und für Grossdatenproduzenten und Verarbeiter.
Erich: Und wenn ich als Firma Microservices in meiner Digitalstrategie verankert habe und meine Reise hinbekommen und ich baue auf das hin, dann ist Headless CMS definitiv das Richtige. Dann macht es Sinn.
Wenn ich aber umgekehrt als Firma wenig Technologiekompetenz in meinem Unternehmen habe, dass alles extern ist, dann würde ich eher davon abraten und es nicht machen. Und dort die Finger davonlassen, das Portemonnaie wird längerfristig Dankeschön sagen.
Dani: Gibt es eine Faustregel, wie viele Kanäle ich bediene, ab wann so ein Headless CMS sich lohnt?
Erich: Ja, theoretisch kannst du sagen, ab zwei. Aber meine Perspektive ist eben, ich kann aus einem klassischen CMS heraus auch verschiedene Templates befüllen. Ich kann auch ein API haben, welches ich Daten nach aussen liefert.
Für mich macht es Sinn, wenn du ab 3-5 Kanäle hast, die beliefert werden. Aber wer ist das? Das ist wirklich jemand, der eine Webseite hat und die gleichen Informationen in einen Android und iOS App liefert und dann vielleicht noch Content hat, dass in Blogsysteme publiziert und veröffentlicht. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt im B2C und B2B Bereich nicht wirklich Unternehmen, wo das Sinn macht.
Dani: Vielleicht bleibt es ein Buzzword und wir werden sehen, das ist sicher ein guter Schluss von diesem Hauptthema. Wir haben es jetzt mal beleuchtet und es passt auch gut zu unserer Ausgabe vom Budget.
Wenn man Budget sparen muss, dann ist eben gesagt hast, das Portemonnaie, das längerfristig Danke sagt. Was aber nicht heisst, dass wir nicht das CMS anbieten, aber eben manchmal braucht es gesunden Menschenverstand.
Dani: Gehen wir aber zu unserem Tooltip der Woche. Das ist heute der ChatGPT 5 Prompt Optimizer for OpenAI. Was kann denn das Tool eigentlich? Hast du es schon getestet?
Erich: Klar. Das war etwas vom Ersten, als die Chat-GPT 5 herauskam. Kurz darauf gab es ein sogenanntes Cookbook von OpenAI.
Dort bin ich über den ChatGPT 5 Prompt Optimizer gestolpert. Das ist ein offizielles Tool von OpenAI. Das ist keine fremde App, die auf einer Webseite läuft und x Werbeeinblendungen hat, sondern ein offizielles Tool von OpenAI. Ich kann dort ein Prompt kopieren, das Tool analysiert den Prompt ,optimiert ihn und gibt mir noch an, warum man etwas optimiert hat, damit ich lernen kann, bessere Prompte zu schreiben.
Dani: Das heisst auch, dass ich weniger Tokens brauche, wenn ich jetzt Prompt absetze, die ich einfach schreibe, vielleicht willkürlich.
Erich: Das müsste man ausprobieren, aber das könnte noch sein. Ich bin der Meinung, dass wir noch etwas gesehen haben in diese Richtung. Strom sparen? Ja. Riesenthema, definitiv.
Dani: Aber wir erinnern uns, in der letzten Folge habe ich auch gesagt, ich habe einen Beitrag gelesen von einer, die sagte: ChatGPT 5 ist nicht schlechter geworden, sondern die Leute können nicht prompten. Vielleicht ist wegen dem der sogenannte ChatGPT Prompt Optimizer entstanden.